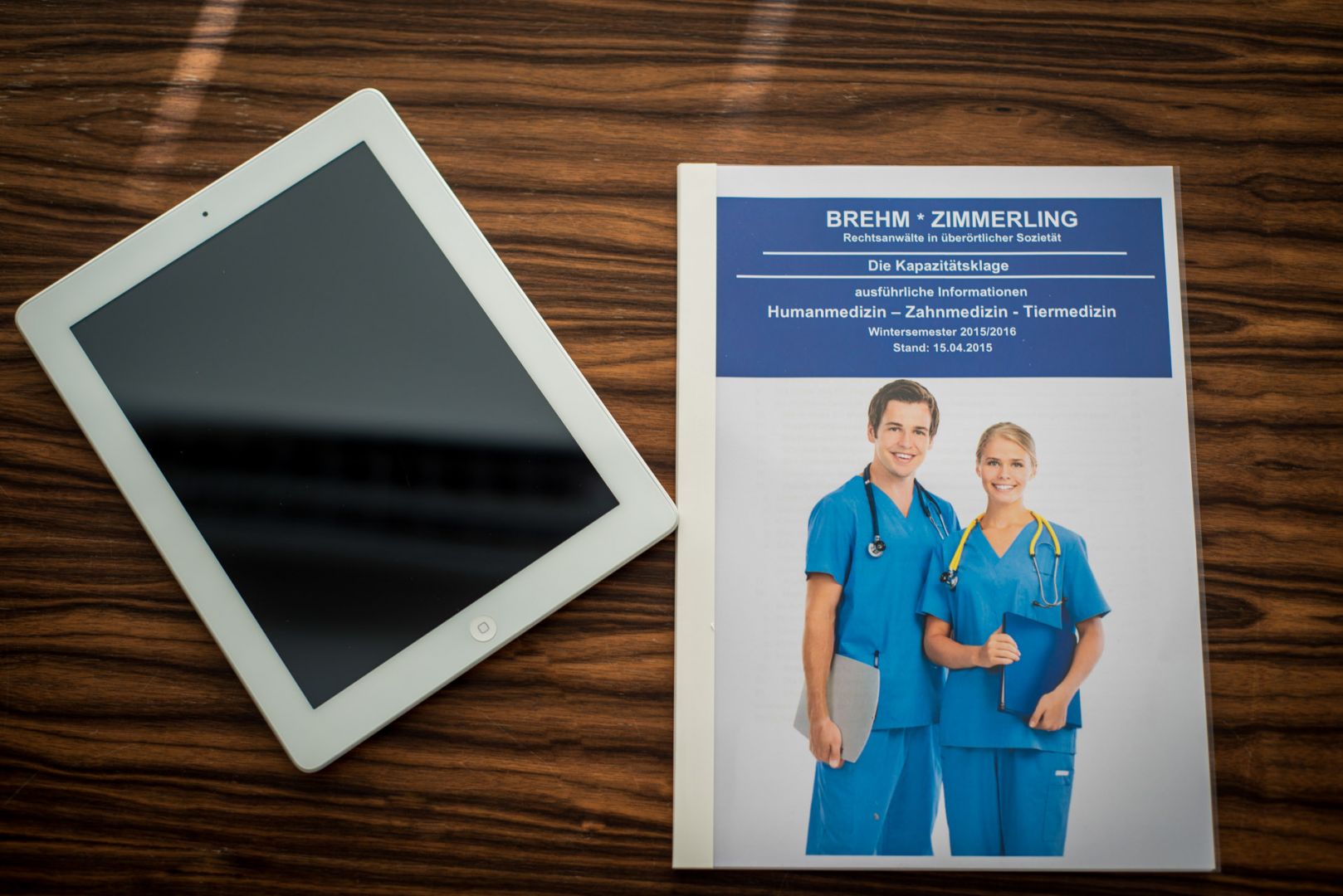Wie funktioniert eine Studienplatzklage?
1. Die Berechnung der Ausbildungskapazität
Grundlage der Studienplatzklage ist die Tatsache, dass die staatlichen Hochschulen in Deutschland verpflichtet sind, so viele Studierende auszubilden wie möglich. Diese Zahl der maximalen Ausbildungskapazität wird für jeden Studiengang und für jedes Semester berechnet. Berechnungsgrundlage hierfür ist die Kapazitätsverordnung KapVO (in manchen Bundesländern heißt die Verordnung anders, ist jedoch im Wesentlichen gleichlautend).
Diese KapVO ist im Prinzip nichts anderes als ein Berechnungssystem für Studienplätze. Hier geht es (in den meisten Studiengängen) darum, ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen dem Lehrangebot und der Lehrnachfrage (personelle Ausbildungskapazität). Das Lehrangebot gibt die zur Verfügung stehende Lehrzeit der Hochschullehrer in Semesterwochenstunden an. Die Lehrnachfrage gibt eine Messzahl aus (den so genannten Curriculareigenanteil), die ausdrückt, wie viele Semesterwochenstunden an Lehrangebot nötig sind, um einen Studierenden auszubilden. Dividiert man das Lehrangebot durch die Lehrnachfrage, erhält man die zur Verfügung stehenden Studienplätze im ersten Fachsemester. Im Anschluss wird diese Kapazität noch durch den Schwundfaktor dividiert. Dieser Schwundausgleich dient dazu, die durch Studienabbruch oder Studienortwechsel in den höheren Fachsemestern sinkenden Studierendenzahlen durch einen Aufschlag im ersten Fachsemester auszugleichen.
Lehrangebot und Lehrnachfrage werden jedes Semester (bzw. in der Regel jedes Studienjahr) anhand der aktuellen tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt. Der Schwundfaktor errechnet sich nach dem so genannten Hamburger Modell aus den Studierendenzahlen (also dem tatsächlich erfolgten Schwund) in den letzten Jahren.
Eine Hochschule errechnet also für einen bestimmten Studiengang eine bestimmte Anzahl an Studienplätzen. Diese Ausbildungskapazität wird dann (je nach Bundesland von der Hochschule selbst oder vom Kultusministerium) festgesetzt.
2. Die innerkapazitären Studienplätze

Die festgesetzten Studienplätze werden im Vergabeverfahren an die Studienbewerber vergeben. Hierbei wird auch immer noch ein Überbuchungsfaktor hinzugefügt. Auch dieser Überbuchungsfaktor muss von den Hochschulen berechnet werden. Hierzu wird das Annahmeverhalten der Studienbewerber aus den letzten Jahren herangezogen. Haben bspw. in den letzten Jahren im Schnitt 80 % der zugelassenen Studienbewerber den Studienplatz angenommen, dann lässt die Hochschule 1,25 Mal (1/0,8) so viele Studienbewerber zu, wie Studienplätze zur Verfügung stehen, so dass bei dem prognostizierten Annahmeverhalten von 80 % genau alle Studienplätze besetzt werden. Werden nicht alle Studienplätze besetzt, werden Nachrückverfahren durchgeführt. Nehmen mehr Studienbewerber den Studienplatz an, als prognostiziert wurde, liegt eine Überbuchung der festgesetzten Zulassungszahl vor.
Die Vergabe der innerkapazitären Studienplätze richtet sich nach den jeweiligen Vergabekriterien (meistens Abiturnote und häufig noch andere Kriterien wie z.B. ein Auswahlgespräch). Die Hochschule erstellt für die Bewerber eine Rangliste nach diesen Kriterien und lässt „von unten nach oben“ zu. Erhält ein Bewerber einen Ablehnungsbescheid, heißt das, dass er auf dieser Rangliste einen so hohen (schlechten) Rangplatz einnimmt, dass er keinen Studienplatz erhalten kann.
Deswegen macht ein Rechtsmittel (Klage oder Widerspruch) gegen den Ablehnungsbescheid in aller Regel überhaupt keinen Sinn; man müsste hier nachweisen, dass die Rangliste falsch ist (was sehr unwahrscheinlich ist).
3. Die außerkapazitären Studienplätze

Erst an dieser Stelle kommen wir bzw. die Gerichte ins Spiel: Die Ausbildungskapazität ist berechnet und die innerkapazitären Studienplätze sind besetzt. Unsere Aufgabe ist es nun, der Universität im verwaltungsgerichtlichen Verfahren „Fehler“ in ihrer Berechnung nachzuweisen. Hierbei geht es nicht so sehr um einfache „Rechenfehler“, sondern um - je nach Hochschule und Studiengang - ganz unterschiedliche Punkte. Zum Beispiel kann es sein, dass eine Hochschule bei der Gewährung einer Deputatsreduzierung einen formalen Fehler begangen hat, so dass diese Deputatsreduzierung unwirksam ist; oder die Hochschule hat bei der Berechnung einer bestimmten Lehrveranstaltung den Veranstaltungsumfang falsch ermittelt. Wir möchten an dieser Stelle aus taktischen Gründen nicht allzu viele Beispiele geben.
Wir möchten andere Anwaltskanzleien hier nicht zu „schlau machen“. Sie können uns aber glauben: Wir haben viele Ideen.
a. Die erste Instanz beim Verwaltungsgericht
In der ersten Instanz gibt es den Amtsermittlungsgrundsatz: Das Verwaltungsgericht prüft von sich aus die Kapazitätsberechnung der Hochschule. Natürlich können die Antragsteller und deren Anwälte hier auch schon vortragen. Das machen wir aber ziemlich ungern. In der ersten Instanz wird nämlich jeder Antragsteller - ungeachtet welchem Anwalt er das Mandat erteilt hat - bei der Vergabe von Studienplätzen berücksichtigt. Findet das Verwaltungsgericht Studienplätze, dann wird in aller Regel ein Losverfahren angeordnet. Die Universität verlost diese weiteren außerkapazitären Studienplätze dann unter allen Studienplatzklägern.
In Medizin oder Zahnmedizin sind dann Zulassungschancen von 1 % bis vielleicht (mit viel Glück) 10 % üblich.
Die Chancen im Studiengang Psychologie liegen hierbei häufig bereits im zweistelligen Bereich.
b. Die zweite Instanz beim Oberverwaltungsgericht / Verwaltungsgerichtshof
Findet das Verwaltungsgericht keine Studienplätze und bestätigt es die Kapazitätsberechnung der Hochschule, weist es die Anträge der Studienplatzkläger durch Beschluss zurück. Gegen diesen Beschluss gibt es die Möglichkeit, ein Rechtsmittel einzulegen: die so genannte Beschwerde (zu vergleichen mit der wohl bekannteren Berufung).
Im Beschwerdeverfahren gibt es eine Besonderheit: Das Gericht der zweiten Instanz berücksichtigt nur den jeweiligen anwaltlichen Sachvortrag. Legen also mehrere Anwaltskanzleien Beschwerde mit jeweils unterschiedlichen Begründungen ein, dann wird das Oberverwaltungsgericht für jede Kanzlei einen gesonderten Beschluss erlassen. Nicht selten bekommen wir so für unsere Mandanten Studienplätze, während andere Kanzleien leer ausgehen. In zweiter Instanz erstrittene Studienplätze sind also viel wertvoller für uns und unsere Mandanten, da die Loschance deutlich höher ist. In zweiter Instanz erreichen wir so Loschancen im zweistelligen Bereich; es kommt auch vor, dass wir genug Studienplätze für alle in diesem Verfahren streitenden Mandanten erhalten.
Der Nachteil der Beschwerdeverfahren liegt naturgemäß in ihrer Dauer. Zunächst mal muss natürlich das Gericht der ersten Instanz entscheiden. Wenn man bei einem langsamen Gericht streitet, kann es durchaus sein, dass der Rechtsstreit insgesamt länger als ein Jahr dauert.
Dies ist aber in den medizinischen Studiengängen zugunsten guter Zulassungschancen sicherlich verkraftbar.
Im Studiengang Psychologie ist es die Ausnahme, dass man einen Studienplatz in zweiter Instanz erstreiten muss. Da wir den Mandanten empfehlen, ca. 10 Universitäten zu verklagen, reichen die Studienplätze der ersten Instanz (kumuliert) meistens bereits für alle Mandanten aus.
Chancen und Kosten

Die Erfolgsaussichten und Kosten einer Studienplatzklage variieren stark je nach gewünschtem Studiengang.
Sie finden Einschätzungen zu Kosten und Chancen sowie unsere bisherigen Erfolgsquoten auf den Seiten des jeweiligen Studiengangs:
Wann sollte man uns beauftragen?
Wir müssen für die Mandanten bereits vor Einleitung der gerichtlichen Verfahren die Verfahren vorbereiten. Hier sind Fristen zu beachten für die außerkapazitären Zulassungsanträge. Diese Zulassungsanträge stellen wir für die Mandanten, sie sind nicht mehr und nicht weniger als Voraussetzung, um später klagen zu können.
Achtung Frist!
In einigen Bundesländern laufen die Fristen für eine Klage zum Sommersemester bereits am 15.01. und zum Wintersemester bereits am 15.07. ab.
Beauftragen Sie uns rechtzeitig, um alle Chancen zu wahren.
Das Kostenrisiko ist auch überschaubar; Mandanten, die uns frühzeitig beauftragen und vor Einleitung der gerichtlichen Verfahren (z. B. durch normale Zulassung) das Mandat beenden, zahlen nur einen Bruchteil unseres üblichen Honorars. Von daher spricht nichts dagegen, auch bei guter Abiturnote zunächst einmal die Fristen und damit die Chancen zu wahren, ggf. zu klagen, falls man im normalen Vergabeverfahren keine Zulassung erhält.
Rufen Sie uns einfach kurz an, dann können wir Ihnen sagen, welche Frist bei Ihrer Wunschuniversität zu beachten ist.
Warum zu uns?
Wir sind kompetent, fair und persönlich.
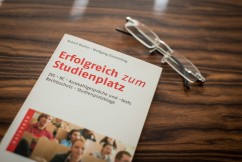
Wir sind seit mehr als 40 Jahren spezialisiert auf das Gebiet des Hochschul- und insbesondere des Hochschulzulassungsrechtes. Wir haben in der Vergangenheit mehrere tausende von Studienplatzklägern vertreten. Wir vertreten allerdings auch zahlreiche Hochschullehrer. Von daher haben wir einen umfassenden Ein- und Überblick in das deutsche Hochschulgeschehen. Wir grenzen uns von denjenigen Rechtsanwälten ab, die das Bundesverfassungsgericht im Zusammenhang mit den Studienplatzklagen bereits vor vielen Jahren als “Trittbrettfahrer” bezeichnet hat. Nach unserer Überzeugung zeichnet sich ein spezialisierter Rechtsanwalt durch Wissen aus und nicht durch Hochglanzwerbung.
Nicht zuletzt dürfen wir uns rühmen, gemeinsam mit Robert Brehm das juristische Standardwerk zur Studienplatzklage geschrieben und zahlreiche Aufsätze zu diesem Thema publiziert zu haben.

Wir versprechen niemandem das Blaue vom Himmel. Die Zeiten einer 100-prozentigen Erfolgschance bei einer Klage z.B. in das 1. Fachsemester Humanmedizin sind ganz einfach vorbei - zu groß die Konkurrenz auch unter den Studienplatzklägern. Auch behaupten wir nicht, durch Mauscheleien mit irgendwelchen persönlich bekannten Professoren Studienplätze für unsere Mandanten erreichen zu können. Wir tragen lediglich mit umfangreichen Schriftsätzen zu Fehlern in den Kapazitätsberechnungen vor und verhandeln persönlich und häufig federführend vor den Verwaltungsgerichten oder direkt mit den Gegenanwälten und Hochschuljustitiaren, um weitere Studienplätze erstreiten zu können.
Bei uns gibt es auch keine versteckten Kosten. Sie vereinbaren mit uns ein Pauschalhonorar und bezahlen uns auch genau dieses und keinen Cent mehr.

Die Studienplatzklagen sind Massenverfahren, ok. Unsere Mandanten sind für uns aber nicht nur “Nummern”. Unsere Mandanten können uns immer (zu Bürozeiten) anrufen und werden nicht abgewiesen. Es ist (fast) immer jemand da, der Auskunft geben kann über den aktuellen Stand der Verfahren, die jeweiligen Chancen etc. Auch auf E-Mails reagieren wir so schnell wie möglich (spätestens am nächsten Arbeitstag).
Im Hinblick auf die Abrechnungspraxis anderer Anwälte erscheint es uns auch angebracht, zu erwähnen, dass wir Telefonate mit Mandanten (oder auch deren Angehörigen) nicht extra berechnen. Die Betreuung der Mandanten gehört zum Mandat!